Land4Climate – Gemeinsam für klimaresiliente Landschaften

Klimawandel, Dürreperioden, Starkregen und Bodenerosion stellen Regionen in ganz Europa zunehmend vor Herausforderungen. Das Projekt Land4Climate zeigt, dass klimaresiliente Landschaften durch naturbasierte Maßnahmen entstehen können – und dass nachhaltiger Wasserrückhalt, Erosionsschutz und landwirtschaftliche Nutzung kein Widerspruch sind.
Download Maßnahmenkatalog
Wasser halten und Böden schützen
Im Mittelpunkt des Projekts steht die Frage, wie Wasser in der Landschaft besser gespeichert werden kann. Ziel ist es, mit naturnahen und kosteneffizienten Lösungen die Auswirkungen des Klimawandels abzufedern und gleichzeitig ökologische, landwirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile zu schaffen.
Durch gezielte Maßnahmen soll die Wasserspeicherfähigkeit der Böden verbessert, die Erosion reduziert und der Abfluss bei Starkregen verlangsamt werden. Das unterstützt nicht nur die Landwirtschaft in trockenen Zeiten, sondern auch die Wasserwirtschaft beim Hochwasserschutz. Entscheidend ist dabei, dass die gesetzten Maßnahmen auf freiwilliger Basis auf privaten Grundflächen umgesetzt und mit den bestehenden Nutzungen abgestimmt werden.
Der neue Maßnahmenkatalog zeigt, wie vielfältig diese Ansätze sein können – von Agroforstsystemen über Mulchsaat, Begrünung von Abflusswegen bis hin zu Geländeanpassungen, Multifunktionshecken und Rückhaltezonen. Dieser soll auch über das Projekt hinaus aufzeigen, welche Maßnahmen möglich sind und zur Umsetzung anregen.
Ein Projekt mit europäischer Dimension
Land4Climate ist Teil des europäischen Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe. Das Projekt wird in sechs europäischen Pilotregionen umgesetzt und verbindet Forschung, Verwaltung, Landwirtschaft und Zivilgesellschaft. Ziel ist es, praxistaugliche Lösungsansätze für klimaangepasste Landnutzung zu entwickeln und europaweit zu verbreiten.
In Österreich liegt der Schwerpunkt im Lafnitztal, einer Region mit sensiblen Gewässer- und Agrarlandschaften, die besonders vom Klimawandel betroffen ist. Hier wird der Maßnahmenkatalog umgesetzt und erprobt. Landwirtinnen und Landwirte im Einzugsgebiet der Lafnitz können freiwillig am Programm teilnehmen.
Das Projekt wird vom BMLUK mit 700.000 Euro unterstützt, von denen 90 Prozent in die konkrete Umsetzung fließen. Ein großer Dank gilt hierbei dem Land Steiermark und dem Land Burgenland, welche die Projektleitung und Umsetzung in Österreich tragen.
Der Maßnahmenkatalog im Überblick
-
Vielfalt & Begrünung
Durch den Anbau verschiedener Pflanzenarten, Zwischenfrüchte, Mischsaaten und Untersaaten wird das Bodenleben aktiviert, die Humusbildung unterstützt und die Wasserspeicherfähigkeit deutlich verbessert. Dauerhafte Begrünung schützt den Boden vor Erosion, verbessert die Durchlüftung und sorgt für stabile, widerstandsfähige Böden, auch bei Extremwetter. Besonders auf erosionsgefährdeten Flächen helfen Begrünungen, den Abfluss zu bremsen und Bodenverluste zu verhindern. Je vielfältiger und konstanter die Vegetation, desto besser funktioniert der natürliche Wasserkreislauf. -
Bodenschonende Bearbeitung
Schonende Bodenbearbeitung ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um Erosion zu verhindern und die Fruchtbarkeit langfristig zu sichern. Reduzierte Bearbeitungsmethoden – von flacher Bodenlockerung über Mulchsaat bis hin zur Direktsaat – erhalten die Bodenstruktur, fördern das Bodenleben, sparen Energie und verringern Treibhausgasemissionen. Durch eine angepasste Bewirtschaftungsrichtung entlang der Höhenlinien lässt sich der Wasserabfluss verlangsamen und der Oberboden schützen. Innovative Technologien wie Flugdrohnen ermöglichen zudem eine präzise Aussaat von Untersaaten und Zwischenfrüchten, selbst auf schwer befahrbaren Flächen -
Nährstoffe und Bodenbiologie
Durch Maßnahmen wie Kompostierung und Gülleaufbereitung werden Nährstoffe im Kreislauf gehalten, Humus aufgebaut und die Bodenstruktur verbessert. Ganzheitliches Weidemanagement fördert zusätzlich die Durchwurzelung und Nährstoffverteilung, stärkt das Bodenleben und verhindert Verdichtung. So entsteht ein widerstandsfähiger, gesunder Boden, der Wasser speichert und Erosion vorbeugt. -
Agroforst und Wassermanagement
Durch die Integration von Bäumen und Sträuchern in landwirtschaftliche Flächen werden Mikroklima, Wasserspeicherfähigkeit und Biodiversität verbessert. Versickerungsgräben speichern Regenwasser, verhindern Erosion und befeuchten trockene Bereiche, während Sammelbecken und Mulden Niederschläge zurückhalten, Versickerung fördern und gleichzeitig wertvolle Lebensräume schaffen. Diese strukturellen Maßnahmen unterstützen nicht nur die landwirtschaftliche Produktivität, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz und zur Stabilisierung der Wasserhaushalte.

Synergien zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft
Land4Climate zeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Naturschutz ist. Durch Maßnahmen, die sowohl landwirtschaftlich nutzbar als auch ökologisch wirksam sind, entsteht ein Mehrwert für alle:
- Landwirtinnen und Landwirte profitieren von stabileren Erträgen, weniger Erosionsschäden und besserer Bodenfeuchte.
- Die Wasserwirtschaft kann durch verbesserten Wasserrückhalt in der Fläche Abflussspitzen reduzieren und die Gewässer durch eine Verringerung des Feinsedimenteintrages schützen.
- Die Umwelt gewinnt durch mehr Biodiversität, lebendige Böden und klimaresiliente Ökosysteme.
Als Ergänzung zum Projekt Land4Climate zeigen auch andere Initiativen, wie wichtig ein nachhaltiger Umgang mit Boden und Wasser für die Zukunft ist. So hat etwa das Land Oberösterreich mit dem Projekt ERWINN (Erosionsschutz und Wasserrückhalt in der Landwirtschaft) wertvolle Grundlagen geschaffen. Der im Jänner 2024 veröffentlichte Endbericht und der dazugehörige Maßnahmenkatalog bieten praxisnahe Ansätze, um Erosion zu vermindern, Wasserrückhalt zu fördern und landwirtschaftliche Flächen klimaresilient zu gestalten.
Weitere Informationen
-
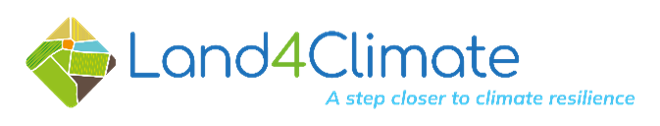
Maßnahmenkatalog Land4Climate
Der vollständige Maßnahmenkatalog zum Projekt Land4Climate (pdf 34,2 MB) -

Land4Climate Website
Zur Website des EU-Projektes Land4Climate. -

Projekt Land4Climate - Klimawandel im Lafnitztal meistern
Das Projekt Land4Climate setzt auf innovative und naturbasierte Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel auf privaten Flächen. -
Endbericht ERWINN
Zum Endbericht des Projekts ERWINN (Erosions- und Wasserschutz Innovationsprojekt 2023-2024) vom Land Oberösterreich.