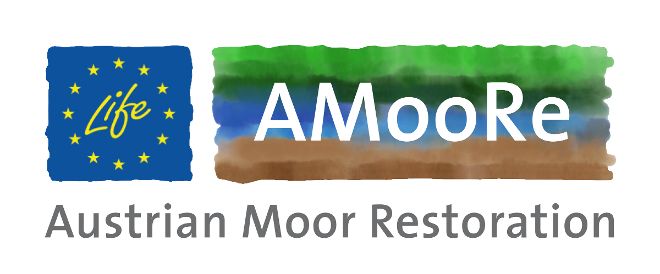LIFE-AMooRe - Moor-Plattform 2025
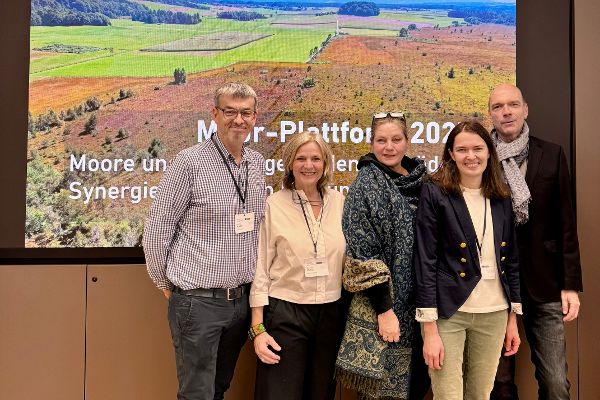
Neues Format für den Moorschutz gestartet!
Am 7. November 2025 fand im Rahmen des EU-Projekts LIFE AMooRe – Austrian Moor Restoration erstmals die nationale Moor-Plattform statt.
Startschuss für die Umsetzung der Moorstrategie Österreich 2030+
Unter dem Leitthema „Moore und ihre umgebenden Torfböden – Synergien zwischen Nutzung und Schutz“ kamen Expertinnen und Experten, Landnutzerinnen und Landnutzer und Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus ganz Österreich zusammen, um über die Zukunft der heimischen Moore zu diskutieren.
Veranstaltet vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) gemeinsam mit dem LIFE-AMooRe-Projektteam, bildet die Moor-Plattform den Auftakt eines mehrjährigen Governance-Prozesses zur Umsetzung der Moorstrategie Österreich 2030+.
Ziel ist es, zentrale Herausforderungen im Moorschutz gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene sektorenübergreifend zu diskutieren und tragfähige Lösungen zu erarbeiten.
„Moore sind wertvolle Klimaschützer und einzigartige Lebensräume. Sie speichern enorme Mengen an Kohlenstoff, regulieren den Wasserhaushalt und bieten seltenen Arten einen wichtigen Rückzugsraum. Mit LIFE AMooRe fördern wir die Umsetzung von Moor-Renaturierungen und schaffen auch ein breites Dialogforum, um Schutz, Nutzung und regionale Entwicklung in Einklang zu bringen. Mein Ressort ist Partner des Projekts und mit einem Eigenanteil von 3,6 Millionen Euro beteiligt, um sensible Ökosysteme zu erhalten und ihre Funktionen für das Klima und die Biodiversität langfristig zu sichern“, betont Umwelt- und Wasserminister Norbert Totschnig anlässlich der Auftaktveranstaltung.

Zwischen Nutzung und Naturschutz: Torfböden als Pufferzonen
Moore und ihre angrenzenden Torfböden sind untrennbar miteinander verbunden. Während Moore naturnahe Lebensräume mit typischen Pflanzenarten darstellen, werden Torfböden meist land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Gerade diese Randbereiche spielen eine entscheidende Rolle: Sie stabilisieren den Wasserhaushalt, wirken als Pufferzonen und bilden die Grundlage für die Regeneration geschädigter Moore.
In Fachvorträgen und Workshops wurden betriebliche, förderpolitische und gesellschaftliche Aspekte der Wiedervernässung diskutiert. Im Mittelpunkt standen Fragen wie:
- Wie kann Moorschutz mit landwirtschaftlicher Nutzung in Einklang gebracht werden?
- Welche Anreize braucht es, um die Wiedervernässung von Moorrändern attraktiver zu gestalten?
„In Zeiten multipler Krisen können wir nur im offenen Dialog gemeinsame Wege finden, um unsere Moore für die Zukunft zu erhalten – gemeinsam mit Grundeigentümerinnen, Bewirtschafterinnen und der Gesellschaft,“ betonte Projektleiterin Christiane Machold.
Neue Daten für den Moorschutz: Das Moorinventar Österreich
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Präsentation des neuen Moorinventars Österreichs, das im Auftrag des BMLUK vom Umweltbundesamt vollständig überarbeitet wurde.
Nach 33 Jahren steht nun eine aktualisierte Moor-Geodatenbank zur Verfügung, die umfassende Informationen über rund 44.000 Hektar Moorfläche liefert – darunter Daten zu Verbreitung, Zustand und ökologischen Merkmalen der heimischen Moore.
Das Moorinventar ist ein zentraler Baustein zur Umsetzung der Moorstrategie Österreich 2030+. Darüber hinaus dient es als wesentliche Grundlage für die EU-Wiederherstellungsverordnung, die Biodiversitätsstrategie und die Klimaschutzziele. Finanziert wurde es aus Mitteln des Biodiversitätsfonds.